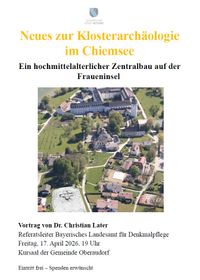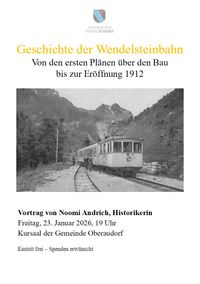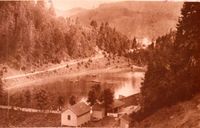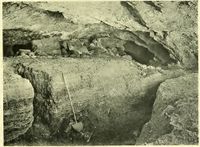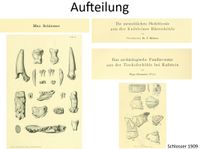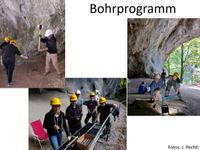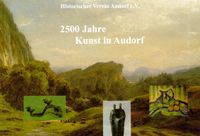Aktuelles und Berichte
Vortrag „Geschichte der Wendelsteinbahn - Von den ersten Plänen über den Bau bis zur Eröffnung 1912“.
Der Historische Verein Audorf e.V. lädt am 23. Januar um 19 Uhr zu einem Vortrag in den Kursaal der Gemeinde Oberaudorf, Kufsteiner Str. 4 ein. Die Historikerin Noomi Andrich spricht über den Bau der Wendelsteinbahn. Dieses spannende Stück Inntalgeschichte behandelte die Referentin in ihrer Bachelorarbeit.
Die Wendelsteinbahn in Brannenburg eröffnete 1912 als erste deutsche Alpenbahn und bringt seitdem Gäste aus aller Welt auf den beliebten Aussichtsberg am oberbayerischen Alpenrand. Doch warum entstand diese erste deutsche Hochgebirgsbahn ausgerechnet am Wendelstein? Welche Rolle spielte dabei der Unternehmer Otto von Steinbeis? Und wie hat die hiesige Bevölkerung auf den Bahnbau reagiert? Diesen und weiteren Fragen geht Noomi Andrich im Vortrag nach und beleuchtet so die Geschichte der Wendelsteinbahn von den ersten Plänen über den Bau bis zur Eröffnung 1912.
Jahreshauptversammlung
Am 19. Februar findet die Jahreshauptversammlung um 19 Uhr in der Gaststätte NordSüd statt, Sportplatzstr. 24, Oberaudorf. Dieses Jahr stehen Neuwahlen an.
Besuch der Ausstellung „Faszination - Sehnsucht – Entdeckung Europäische
Landschaftsmalerei im 17. und 18. Jahrhundert“ im Barockmuseum Oberaudorf
Am Freitag, den 14. November, statteten wir wieder einmal dem Barockmuseum Oberaudorf einen Besuch ab. Mit dem Titel „Faszination - Sehnsucht – Entdeckung Europäische Landschaftsmalerei im 17. und 18. Jahrhundert“ präsentierten der Inhaber des Museums, Restaurator Jürgen Jung zusammen mit seinem Kollegen Raimund Schreiber eine Auswahl erlesener Gemälde aus eigenem Besitz und Leihgaben privater Sammler und Museen. Nach Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Dank an Jürgen Jung dafür, dass er die Vereinsmitglieder durch die Ausstellung führen werde, freute sich dieser seinerseits sehr, dass der Verein wieder bei ihm zu Besuch war.
Jürgen Jung erläuterte zunächst Grundsätzliches zur Landschaftsmalerei in der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts. Dabei wies er ausdrücklich darauf hin, dass die Künstler des 19. Jahrhunderts diese frühe Landschaftsmalerei und ihre Prinzipien zum Vorbild genommen haben. Nicht zuletzt namhafte Vertreter der sogenannten Münchner Schule wie Carl Spitzweg und Eduard Schleich d. Ä. besuchten niederländische Gegenden und kopierten die Gemälde in den großen Museen.
Jürgen Jung erläuterte, wie er und sein Kollege Raimund Schreiber oft Gemälde in Auktionen entdeckt haben und wie es ihnen gelang, den Künstler ausfindig zu machen, der es vor rund 300 Jahren gemalt hatte. Groß war dann die Freude und nicht selten tauchte beim Reinigen der alten Schmutzschicht plötzlich sogar die Signatur des Künstlers auf.
Beim Gang an den vielen herrlichen Gemälden entlang erklärten Jürgen Jung und Raimund Schreiber, dass die Bilder nach Herkunftsländern und innerhalb eines Landes chronologisch geordnet wurden, um so besser die Veränderungen in den Darstellungen im Laufe der Zeit erkennbar zu machen. Auch von Land zu Land waren die unterschiedlichen Auffassungen gut festzustellen.
Im Erdgeschoss des Museums waren Gemälde niederländischer und flämischer Künstler zu sehen, im Untergeschoss die Bilder der Vertreter aus England, Frankreich, Deutschland und Österreich. Hilfreich zur Unterscheidung der Herkunftsländer der Maler war auch die unterschiedliche Farbgestaltung der Wände. Erstaunlich war zu erfahren, dass der früheste Künstler bereits vor 400 Jahren seine Bilder gemalt hat.
Gleich zu Beginn erklärte Jürgen Jung, dass die dargestellten Landschaften stets in der Phantasie des Künstlers entstanden waren. Erst zum Ende des Betrachtungszeitraumes wurden reale Landschaften gemalt. Die dargestellten Figuren hatten unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen: Im einfachsten Fall dienten sie dazu, das Raumempfinden zu verstärken, in dem sie mit der Entfernung immer kleiner dargestellt wurden. Häufig stellten sie mythologische Szenen dar und nicht selten geben sie uns einen Eindruck in das damalige ländliche Leben der Menschen.
Bereits im 17. Jh. haben Künstler aus dem Norden Europas sehnsuchtsvoll Italien bereist, um sowohl das völlig andere Licht als auch die gänzlich unterschiedliche Landschaft und die antiken Stätten kennenzulernen.
Bei der Verabschiedung bat Jürgen Jung die Vereinsmitglieder, doch reichlich Werbung für die Ausstellung zu machen, denn es lohne sich - wie wir alle feststellen durften – wirklich, das kleine Museum in Oberaudorf zu besuchen. Alle Interessierten bekamen den Katalog geschenkt, der sämtliche ausgestellten Werke zeigt.
Nach dem Ausstellungsbesuch ging ein Großteil der Teilnehmer mit zur Gaststätte NordSüd, wo es ausreichend Gelegenheit gab, sich über das Gesehene auszutauschen.
Exkursion zum Kloster Raitenhaslach und zur Höhlenburg nach Stein an der Traun
Am regnerischen 11. September führte die Busfahrt Mitglieder und Gäste des Historischen Vereins Audorf über Traunstein vorbei am Waginger See zum Kloster Raitenhaslach an der Salzach. Auf dem Gelände des ehemaligen Klosters empfing uns die vom Touristenbüro Burghausen engagierte Gästeführerin Margret. Mit einer gehörigen Portion Lokalkolorit erläuterte sie die Geschichte des Zisterzienser Klosters, welches auf Drängen des Salzburger Bischofs 1146 von Schützing an der Alz nach Raitenhaslach verlegt wurde. 1186 wurde die im romanischen Stil errichtete Pfeilerbasilika geweiht. Im 13. und 14. Jahrhundert zählte die Abtei zu den reichsten Klöstern Altbayerns. Ab etwa 1690 begann eine Phase großer Bautätigkeit. Unter Abt Emanuel II. Mayr wurden prächtige Neubauten und Ausstattungen geschaffen. Die Bibliothek wird 1785 eingeweiht. Die Kirche ließ man im Stil des Barock umbauen und sie erhielt innen eine Ausstattung im Rokokostil.
Die Kirche diente als Grablege für Mitglieder des Hauses Wittelsbach. Die Fresken stammen von Johann Zick, die Rokoko-Innenausstattung, die Altäre sowie die historischen Kapellen gelten als herausragend.
Für uns als geschichtsbewusste Besucher öffnete Gästeführerin Margret eine Tür im ehemaligen Kreuzgang zu Ausgrabungen, bei denen die Fundamente und Mauerreste der ehemalig romanischen Basilika freigelegt wurden. Die Ausgrabungen fanden im Zuge der Restaurierungs- und Untersuchungsarbeiten nach der Übernahme durch die Stadt Burghausen ab 2003 statt.
Ein Rundgang durch den ehemaligen Klostergarten, vorbei an zahlreichen interessanten Gebäuden einschließlich Grundschule und Kindergarten, sowie Blick auf die unterhalb vorbeifließende Salzach, bildete den Abschluss der Besichtigung Raitenhaslach.
Nach halbstündiger Busfahrt erreichten wir Altenmarkt an der Alz und stiegen unmittelbar vor dem zur Klosterbrauerei Baumburg gehörenden Bräustüberl aus, um dort unsere Mittagspause zu verbringen.
Danach hatten wir Gelegenheit, die Pfarr- bzw. Stiftskirche St. Margareta in Baumburg, ehemals Teil des Augustiner Chorherrenstifts, zu besichtigen. Wegen Arbeiten an der Westfassade war sie eigentlich geschlossen, für die Exkursion des Historischen Vereins Audorf wurde sie freundlicherweise aufgeschlossen. Einige Informationen zur Baugeschichte und zur Innenausstattung der Kirche gab der 1. Vorsitzende, Norbert Schön. Im frühen 12. Jahrhundert wurde an der Stelle eines nur kurzzeitig bestehenden Klosters ein Augustiner-Chorherrenstift eingerichtet, zu dem die 1129 dem heiligen Nikolaus geweihte Kirche gehörte. Wenige Jahre später erfolgte der Bau einer neuen romanischen Basilika mit beträchtlichen Ausmaßen, in der im Jahr 1140 die Altarweihe stattfand. 1756 ließ man auf den Grundmauern dieser Kirche, von der nur die Türme mit ihren Zwiebelhauben und die unteren Teile der Umfassungsmauer erhalten blieben, einen barocken Neubau errichten. Gleichzeitig erhielt die Kirche ihre heute noch vorhandene Ausstattung im Stil des Rokoko. Das holzgeschnitzte, mit Intarsien verzierte Chorgestühl im Stil der Renaissance wurde aus der Vorgängerkirche übernommen und durch Ornamente im Stil des Rokoko ergänzt.
Als es die zuständige Dame des Pfarramtes auf Bitten des Vorstandes hin ermöglichte, dass unser Vereinsmitglied Elmo Holler die Kirchenorgel spielen durfte, erlebten wir ein echtes Highlight. Da waren dann wirklich alle sehr beeindruckt, wie ein Kirchenbau zum Klingen gebracht werden kann.
Nur einen Steinwurf entfernt von Baumburg erreichten wir als letzten Ort unserer Exkursion Stein an der Traun. Nahe am Zusammenfluss der Alz und der Traun erhebt sich eine Nagelfluhwand, auf deren Rücken sich ein gedrungener Schlossbau aus der Zeit um 1500 befindet, das Hochschloss. Zusammen mit dem Unteren oder Neuen Schloss am Fuß der Felswand und der zwischen beiden gelegenen Höhlenburg bildet sie die Burganlage Stein, die dem Dorf ihren Namen gab.
Auf dem Gelände der Schlossbrauerei empfingen uns die beiden Burgführer Pius und Herbert. Pius wies darauf hin, dass sie sich noch nie so ausführlich auf eine Führung vorbereitet hätten wie auf unsere. Der Vorstand hatte nämlich vorab darum gebeten, mehr als üblich auf die geschichtlichen Hintergründe von Schloss Stein einzugehen und nicht nur auf die Legende vom bösen Raubritter Heinz vom Stein.
Wegen des Nieselregen setzten die Beiden ihre Einführung dann im Informationsraum der Brauerei fort.
Pius erklärte uns, wie der Nagelfluh, auch „Herrgottsbeton“ genannt, in der vorletzten Eiszeit entstanden ist. Bereits in diesem Nagelfluhrücken wurden nach Abschmelzen des Gletschers Höhlen ausgewaschen. Im Erdwall, der das spätere Hochschloss umgab, fanden die Archäologen Hinweise auf steinzeitliche und keltische Nutzung des Areals. Das heutige Hochschloss geht auf einen Steinbau des frühen 11. Jahrhunderts zurück. Ursprünglich hatte die obere Burg offenbar die Aufgabe, den Salzhandel durch das Trauntal und den Flussübergang zu schützen. Durch die Herausbildung einer Hofmark wurde später ein Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum notwendig. Von 1254 bis 1809 gehörte das Hochschloss zu Salzburg, während die beiden späteren Burgen bayerisch waren. Hier erkannten wir durchaus Parallelen zur mittelalterlichen Entwicklung von Audorf. Ausführlich gingen beide Burgführer auf die Adelsgeschlechter ein, die Schloss Stein nach und nach besessen haben.
1934 erwarb Max Wiskott Schloss und Gut Stein. Die Wiskotts gründeten die Schlossbrauerei, und richteten Gymnasium und Internat Schloss Stein ein. Eine erste Brauerei auf dem Schlossgelände ist bereits 1489 gegründet worden.
Im Rahmen seiner Ausführungen wurde Burgführer Pius nicht müde zu betonen, dass doch sehr viel dafür spreche, dass es einen Heinz von Stein im 12./13. Jh. tatsächlich gegeben hat. Pius erklärte die heutige Struktur der Anlage, die aus Brauerei, Höhlenburg, Hochschloss und Privatschule besteht. Zu beachten ist, dass das Hochschloss auf einem Teil der Brauerei steht. Von 1700 bis 1934 gab es seitlich der Höhlenburg im Nagelfluhberg eine hölzerne Eremitage. Ganz besonders wies er darauf hin, dass die Höhlenburg in ihrem Ursprungszustand erhalten, aber nicht saniert wurde.
Da für die beschwerliche Begehung der eigentlichen Höhlenburg die zulässige Personenzahl begrenzt ist, musste sich die Gruppe aufteilen. Der größte Teil ging mit Burgführer Herbert in die Höhlenburg.
Eine kleinere Gruppe ging mit Burgführer Pius nach oben zum Oberschloss. Dort gab es eine Präsentation aller Biere der Schlossbrauerei Stein und eine Verkostung. Später stieß die Gruppe dazu, welche die Höhlenburg empor gestiegen war.
Eine dritte Gruppe blieb unten im Bereich der Brauerei und besuchte das Bräustüberl, wo sie auf die zurückkehrenden Besucher des Oberschlosses warteten. So ging es schließlich am Chiemsee vorbei zurück. Mit vielen interessanten und neuen Eindrücken kehrten die Teilnehmer der Exkursion am Abend zurück nach Oberaudorf.
Ein besonderer Dank galt dem Busfahrer, der geduldig auf die etwas verspätete Rückfahrt wartete und mehrere Straßensperrungen sehr umsichtig umfahren hatte.
Eröffnung des "Oberaudorfer Geschichtsweges"
Nach einer längeren Planungs- und Realisierungsphase wurde am Sonntag den 18. Mai bei bestem Wetter der "Oberaudorfer Geschichtsweg" eröffnet. Dieses Ereignis wurde bewusst auf den "Internationalen Museums Tag" gelegt. Auf Einladung der Tourist-Information der Gemeinde trafen sich die Teilnehmer der Veranstaltung vor dem Rathaus und wurden vom Bürgermeister Dr. Bernhard begrüßt. Michael Steigenberger und Norbert Schön gingen auf die Zusammenarbeit von Gemeinde und Verein bei der Ausarbeitung eines Geschichtsweges ein, welcher die 3500jährige Siedlungsgeschichte von Oberaudorf erlebbar machen sollte. Der Wanderweg durch die Oberaudorfer Geschichte wird in dem neu aufgelegten Faltblatt dokumentiert und führt entlang von insgesamt 9 Informationstafeln, davon fünf bereits bestehenden und vier neu gefertigten.
Die Teilnehmer der Eröffnungsveranstaltung, überwiegend Vereinsmitglieder, spazierten dann zur Ruine der Auerburg auf den Schloßberg, weiter auf den Florianiberg und schließlich zum Luegsteinsee. Dabei konnten Informationen zu wichtigen Phasen der Oberaudorfer Besiedlung wie Bronzezeit, Eisenzeit/Kelten, Mittelalter, Gericht Auerburg und Tourismus erwandert werden.
Michael Steigenberger gab an den Infotafeln zusätzliche Informationen, die von den Teilnehmern wissbegierig aufgenommen wurden.
Die Veranstaltung wurde mit einem Gläschen und Knabbereien, welche die Damen von der Touristinfo bereit hielten, im Museum im Burgtor gemütlich abgeschlossen.
Exkursion zum Blaahaus in Kiefersfelden
Vor dem Blaahaus in Kiefersfelden trafen sich am 10. April zahlreiche Vereinsmitglieder, um die neu gestaltete Ausstellung „Industriemuseum Blaahaus Kiefersfelden“ zu besichtigen. Der 1. Vorsitzende begrüßte die Teilnehmer und bedankte sich bei Peter Neumann vom Team des Museums dafür, dass wir das Museum außerhalb der geregelten Besuchszeiten besichtigen konnten. Besonderer Dank galt Martin Hainzl, dem kundigen Ortschronisten, der sich bereit erklärt hat, uns durch die Ausstellung zu führen.
Titelseite des Flyers
Zunächst erinnerte der Vorsitzende daran, dass Kiefersfelden, Ober- und Niederaudorf zum Zeitpunkt des Beginns der Industrialisierung von Kiefersfelden um 1600 zum Pfleggericht Audorf gehört haben. Beachtenswert ist, dass ab diesem Zeitpunkt Kiefersfelden infolge dieser Industrialisierung eine völlig andere Entwicklung erlebt hat als die beiden anderen Orte. Ober- und Niederaudorf blieben, so wie Kiefersfelden zuvor auch, landwirtschaftlich geprägt. Im 19. Jahrhundert hat sich dann in Ober- und Niederaudorf der Tourismus als Wirtschaftszweig stark entwickelt.
Begrüßung vor dem Blaahaus, Martin Hainzl Mitte hinten
Martin Hainzl gab zur Einführung einen kurzen Überblick über die Industriegeschichte von Kiefersfelden und die Bedeutung des Blaahauses. Erst ein zwischen dem Herzogtum Bayern und Österreich abgeschlossener Vertrag zum Transport der im Bereich von Thiersee abgeholzten Bäume über den Kieferbach ermöglichte einen Standort zur Eisenverarbeitung in Kiefersfelden.
Anschließend sahen sich die Teilnehmer im Erdgeschoss des Blaahauses um. Dieses bietet neben dem Empfang einen großen Versammlungsraum, mehrere Räume mit der Schilderung des Lebens der Hüttenwerksarbeiter und zwei Ausstellungsräume.
Im 1. Obergeschoss begann die eigentliche Präsentation der Industriegeschichte mit der Abteilung „Trift & Köhlerei“. Äußerst anschaulich kommentierte Martin Hainzl das beeindruckende Video der schweren und gefährlichen Arbeit zur Gewinnung des bei der Eisenerzverhüttung notwendigen Holzes.
Videopräsentation der Holztrift
An einem alten Foto erläuterte Martin Hainzl das ehemalige Gebäude des „Großen Hammers“, welches nach Stilllegung der Eisenindustrie vom nachfolgenden Marmorwerk weiter genutzt worden ist, allerdings ohne den gewaltigen Schornstein. Wie dieser „Große Hammer“ tatsächlich ausgesehen hat, konnte man sehr schön an dem in einem eigenen Raum aufgestellten Modell sehen. In diesem Raum stehen die exakt nachgebauten Modelle des „Großen Hammer“ und des „Kleinen Hammer“. So nannte man die Bauwerke der Eisenverhüttung, in denen die Verarbeitung des Eisenerzes und die Bearbeitung des Roheisens stattgefunden hat.
Raum mit den Modellen vom „Großen Hammer“ und vom „Kleinen Hammer“
Interessant waren die Ausführungen Hainzls zu den sozialen Folgen der in großer Zahl mit der Errichtung des Eisenhüttenwerkes verbundenen Neuansiedlung von Tiroler Arbeiterfamilien. Sie waren deutlich in der Überzahl gegenüber den Einheimischen. Unser 2. Vorsitzender Michael Steigenberger konnte die Informationen von Martin Hainzl zu der den Tirolern vertraglich zugesicherten eigenen Gerichtsbarkeit ergänzen. Der ständige Streit, ob für die Hüttenwerksarbeiter die Tiroler Gerichtsbarkeit oder das Pfleggericht Auerburg zuständig sei, konnte vertraglich zugunsten des Pfleggerichts Auerburg gelöst werden.
In einem eigenen Raum wird die Sensenherstellung in der im Ortsteil Mühlbach angesiedelten Bayrisch – Tiroler Sensenfabrik geschildert. Diese im Vergleich zur Kieferer Eisenhütte kleine Produktionsstätte hat ihre qualitativ hochwertigen Produkte weltweit vermarktet und fiel dem Konkurrenzdruck zum Opfer, einem Schicksal, das auch schon die Eisenindustrie Kiefersfeldens beendet hatte.
Spannend war dann auch die Geschichte, die uns Martin Hainzl über die einem Zufall zu verdankende Ansiedlung der Marmorindustrie am Standort der vorherigen Eisenindustrie erzählen konnte. Das Museum zeigt eindrücklich die Arbeit und die Produkte dieses weit über die Grenzen hinaus erfolgreichen Betriebes.
Der Zementproduktion ist ein weiteres Kapitel des Industriemuseums gewidmet. Nicht zuletzt dank seiner akribischen Recherchen in den Archiven der Gemeinde konnte Martin Hainzl den ständigen Kampf zwischen Betreiber und Standortgemeinde schildern. Wirtschaftskraft auf der einen, Umweltbeeinträchtigungen auf der anderen Seite haben diesen „Kampf“ geprägt.
Ganz in seinem Element war Hainzl dann in der Abteilung „Theater, Musik & Gesellschaft“, dem letzten Abschnitt des Industriemuseums. Er, der selbst unverwechselbar meist die „Bösen“ im Theater Ritterschauspiele Kiefersfelden verkörpert hat, konnte als Chronist des Theaters viel Wissenswertes über dessen Geschichte erzählen. Besonders stolz erklärte er, wie es ihm gelungen war, das hölzerne Modell der „Comedihütte“ wieder nach Kiefersfelden zurückzuholen. Dieses wurde 1928 vom Theatermuseum Köln in dessen hauseigener Modellwerkstatt angefertigt. Dort war es dann auch eingelagert, ohne dass dies bekannt war. Martin Hainzl konnte es ausfindig machen und für das Blaahaus als Dauerleihgabe gewinnen.
Da derzeit in den beiden Ausstellungsräumen des Blaahauses die Kiefersfeldener Keramik-Künstlerin Hildegard Prinz ihre Werke ausstellt, konnten sich Interessierte im Beisein der Künstlerin dort umsehen.
Nachdem sich der 1. Vorsitzende Norbert Schön bei Martin Hainzl für dessen interessante Führung bedankt hatte, ging es in die Kohlstatt zu einer gemütlichen Einkehr beim Schaupenwirt. Die meisten Teilnehmer ließen zusammen mit Peter Neumann und Martin Hainzl den informativen Museumsbesuch ausklingen.
Vortrag "Die Römer am Inn"
Am 16. April konnte der 1. Vorsitzende des Historischen Vereins Audorf e.V. eine große Zahl Vereinsmitglieder und Gäste im Kursaal begrüßen. Erfreulicherweise hatte sich Dr. Bernd Steidl bereit erklärt, einen Bildervortrag mit dem Titel „Die Römer am Inn“ zu halten. Er ist Abteilungsleiter für die Römerzeit an der Archäologischen Staatssammlung München.
Oben der Referent Dr. Bernd Steidl und unten Vereinsmitglieder und Gäste im gut besetzten Kursaal
Zu Beginn seines Vortrages ging Dr. Steidl ausführlich auf die Erforschung der bayerischen Geschichte und die Anfänge der Archäologie in Bayern ein. Er begann mit dem bayerischen Geschichtsschreiber Johannes Turmair, genannt Aventin. Er erforschte im Auftrag des bayerischen Herzogs Wilhelm IV. die Geschichte der Wittelsbacher, welche 1521 in den „Annales Ducum Boiariae“ erschienen ist. Als Nächstes ging Dr. Steidl auf die Abschrift einer karolingischen Vorlage eines römischen Straßenverzeichnisses - also eine Art Reiseplan – dem „Itinerarium Antonii“ von 1542 ein. Darin finden sich römische Ortsnamen aus der Gegend am Inn bei Rosenheim. Johann Georg Dominicus von Linprun, bayerischer Gelehrter des 18. Jahrhunderts, Mitglied und Begründer der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, erforschte und dokumentierte römische Straßen, Meilensteine, Kastelle und Siedlungen in Bayern. Schließlich kam der Referent zu den Nachforschungen des Landrichters Josef von Kloeckel über die römischen Denkmäler in der Gegend von Rosenheim von 1807. Joseph von Stichaner arbeitete als Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften an der „Sammlung römischer Denkmäler in Baiern“ mit. Durch Stichaners akribische Dokumentation legte das Königreich Bayern den Grundstein für die heute international geschätzte Archäologische Staatssammlung in München, die noch immer zu den führenden römischen Sammlungen Deutschlands zählt. Zu diesen Funden zählt auch römische Keramik aus der Gegend um Rosenheim.
Ein weiterer wesentlicher Schritt in den Anfängen der bayerischen Archäologie war das von König Max I. Joseph 1808 erlassene Gesetz, welches besagt, dass jeder Fund altertümlicher Gegenstände der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu melden sei und überdies die Akademie den Auftrag erhielt, entsprechende Funde zu sammeln. Anhand der Dokumentation Stichaners lässt sich nachweisen, dass Johann Wolfgang von Goethe einige römische Keramiken aus der bayerischen Sammlung besessen hat.
Antiquarium der Münchner Residenz
Römische Keramik aus Goethe´s Sammlung
Dann ging Dr. Steidl detailliert auf die Entdeckungen der nördlich von Rosenheim gelegenen römischen Siedlungen „Pons Aeni“ auf der westlichen Innseite und „Ad Enum“ auf der östlichen Innseite ein. Pons Aeni gehörte der römischen Provinz Raetien, Ad Enum der Provinz Noricum an.
Karte mit den Provinzen Raetien und Noricum
Die folgende Übersichtskarte links zeigt die Standorte der Funde in der Region von Pons Aeni.
In der Karte oben ist die Lage der beiden römischen Ortschaften westlich und östlich des Inns markiert (grau hinterlegt) und sie zeigt die Lage der Innbrücke nördlich davon. Zur Römerzeit war es eine von drei Brücken zwischen Innsbruck und Passau und hatte somit große Bedeutung für die Truppen und für den Warentransport.
Im nächsten Teil berichtete Dr. Steidl über die Grabungen in Ad Enum und Pons Aeni in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Ausgrabung bei Pons Aeni, 1969
Funde von der Ausgrabung bei „Pons Aeni“
Ein Highlight für die bayerische Archäologie der Römerzeit bildete die Entdeckung eines Mithrastempels (Mithräum) in Mühltal südlich von Rosenheim auf der östlichen Innterrasse.
Ausgrabung am Mithräum in Mühltal 1978
Funde aus dem Mühltaler Mithräum
Der Mithrastempel wurde 1978–1980 von der Prähistorischen Staatssammlung München ausgegraben und untersucht. Der Standort steht in direktem Zusammenhang mit der römischen Zollstation und Brückenanlage Pons Aeni, die den Innübergang zwischen den Provinzen Raetien und Noricum sicherte und zollamtlich überwachte. Das Mithräum war ca. 12 m lang und 9 m breit. Ein Weihealtar zeigt, dass das Heiligtum spätestens ab der 2. Jahrhundertshälfte bestand. Der Mithraskult war eine mystische Religion im Römischen Reich, die sich im 1. bis 4. Jahrhundert n. Chr. vor allem unter Soldaten und Beamten großer Beliebtheit erfreute . Es handelt sich um einen geheimnisvollen Mysterienkult um die Gottheit Mithras, der vermutlich aus persisch-iranischen Wurzeln hervorging, aber in Rom ganz eigenständig weiterentwickelt wurde.
Dem Mithraskult und den Eigenheiten der zugehörigen Skulpturen und Reliefs widmete Dr. Steidl einen großen Teil seines Vortrages. Aus den Fragmenten der Inschriften konnten wichtige Informationen über Stifter, Zeitpunkt der Stiftung etc. gewonnen werden. Er erklärte weiter die große Bedeutung des Zollwesens in der Römerzeit. Einer der Zollbeamten war ein gewisser „Fructus“, der das Mithräum von Mühltal gestiftet hatte. Inschriften auf weiteren Mithräen in Slowenien und Kroatien weisen auf römische Zollbeamte hin, die auch in Pons Aeni tätig waren.
Eine der wichtigsten Landverbindungen der Römer war die Straße von Innsbruck an Kiefersfelden/Oberaudorf vorbei nach Rosenheim und weiter nach Regensburg. Die folgende Karte kennzeichnet diese wichtige Verbindung.
Dazu passt die bronzene Karosserieaufhängung mit Darstellung des Hercules, die bei Kiefersfelden gefunden wurde. Sie war ursprünglich eine von 4 Aufhängungen eines römischen Reisewagens.
Ein wichtiges Handelsgut der Römer stellte die „Terra Sigillata“ dar. Eine sehr große Produktionsstätte dieser Ware konnte in Westerndorf bei Rosenheim nachgewiesen werden. Umfangreiche Keramik-Funde geben Zeugnis davon.
Ein großer Brennofen produzierte erhebliche Mengen an Gefäßen und anderen Gebrauchsgegenständen aus gebranntem Ton. Die beiden Fotos unten zeigen Beispiele davon sowie das Ausmaß einer Fundstätte. Die Verteilung der Ware aus dieser Produktionsstätte konnte über weite Bereiche Osteuropas nachgewiesen werden.
Abschließend zeigte Dr. Steidl dann noch Funde aus der Römerzeit, die auf Almwirtschaft oberhalb der Ruine Falkenstein, zwischen Petersberg und Rachelwand hinweisen.
Übersichtskarte des Fundbereiches
Funde einer römischen Almwirtschaft zuzurechnender Behältnisse und Geräte oberhalb von Flintsbach
Nach Ende seines von Zuhörern heftig beklatschten Vortrages stand Dr. Steidl noch für die Beantwortung zahlreicher Fragen zur Verfügung. Danach bedankte sich der Vorsitzende bei ihm herzlich und wünschte allen einen guten Nachhauseweg.
Jahreshauptversammlung 2025
Am 17. Februar 2025 fand in der Oberaudorfer Privatbrauerei die Jahreshauptversammlung des Historischen Vereins Audorf e. V. statt. Nach der Begrüßung und dem Totengedenken zeigte der 1. Vorsitzende, Norbert Schön, in seinem Bericht zunächst den Stand der Mitglieder auf. Derzeit hat der Verein 150 Mitglieder. Bei der letzten Jahreshauptversammlung waren es noch 157 Mitglieder, 13 Mitglieder sind ausgeschieden, 6 Mitglieder neu im Verein. Die erste vom Verein organisierte Exkursion führte nach Rosenheim zur Ausstellung "Sehnsuchtsblaue Ferne! Der Münchner Landschaftsmaler August Seidel (1820-1904) und Weggefährten". Im April war das Museum auf der Festung Kufstein das Ziel, ehe es im Mai mit dem Bus zur diesjährigen Bayerischen Landesausstellung „Tassilo, Korbinian und der Bär – Bayern im frühen Mittelalter“ nach Freising ging. Die letzte Exkursion führte Vereinsmitglieder und Gäste im Oktober nach Aschau zur Besichtigung von Schloss Hohenaschau und das historische Aschau. Die beiden Vortragsveranstaltungen behandelten die Themen "Erkenntnisse früherer und aktueller archäologischer Grabungen in der Tischoferhöhle im Kaisertal" sowie "Besuchermagnet Oberaudorf – Vom prominenten Gast zum Tourismus". Zuletzt gab Norbert Schön einen Ausblick auf Veranstaltungen des kommenden Vereinsjahres.
Es folgten die Berichte der Schriftführerin Sigrid Schön und der kommissarischen Schatzmeisterin Ruth Goinger. Die beiden Rechnungsprüfer Maria Krenek und Paul Funk bescheinigten eine ausgezeichnete Kassenführung, sodass der kommissarischen Schatzmeisterin und dem Vorstand Entlastung erteilt werden konnte.
Nachdem im Oktober letzten Jahres der Schatzmeister Bernd Vinzenz nach kurzer schwerer Krankheit gestorben war, musste ein Nachfolger gewählt werden. Ohne Gegenstimme wurde Ruth Goinger als neue Schatzmeisterin gewählt.
Beim Tagesordnungspunkt "Wünsche und Anträge" trugen mehrere Vereinsmitglieder ihre Wünsche vor, die vom Vorstand bearbeitet werden.
Vortrag "Besuchermagnet Oberaudorf - Vom prominenten Gast zum Tourismus"
Im Evangelischen Gemeindehaus Oberaudorf begrüßte der 1. Vorsitzende des Historischen Vereins Audorf, Norbert Schön, am 20. Dezember 2024 zahlreiche Zuhörer zu seinem Vortrag. Sein Dank galt zunächst Pfarrer Nun für die Zurverfügungstellung des Gemeindehauses, Josef Obermayer für die Mithilfe und die Überlassung zahlreicher Dokumente aus seinem Archiv sowie Martina Schweinsteiger, Leiterin der Tourist – Information Oberaudorf, für ihre Unterstützung.
Erste Besucher um 1800
Nur rund 50 Jahre nach der Zerstörung eines großen Teils von Oberaudorf durch Panduren im Rahmen des österreichischen Erbfolgekrieges besuchten erste Künstler wie der Landschaftsmaler und Galeriedirektor Johann Georg von Dillis oder der Pfälzer Landschaftsmaler Ludwig Neureuther Oberaudorf und hielten insbesondere die Oberaudorfer Dorfbevölkerung in ihren Arbeiten fest. Zuvor machte bereits Lorenz von Westenrieder, Theologe, Pädagoge, Historiker und Publizist der Aufklärung die Vorzüge der Brannenburger Umgebung bekannt. Der Verwaltungsjurist Joseph Ritter von Hazzi stattete 1796 Oberaudorf einen Besuch ab und beschrieb Oberaudorf und dessen Gastfreundschaft.
Ludwig Neureuther „Innthal - Audorf“, um 1800
Adelige, Militärs und Künstler beim Weber an der Wand
Eine wesentliche Voraussetzung zum Besuch von Oberaudorf waren die Gasthäuser und der Personentransport. Um 1800 gab es bereits 7 Gasthäuser. Seit 1776 betrieb Thurn & Taxis einen regelmäßigen Postverkehr von München über Aibling nach Kufstein und weiter nach Innsbruck.
Der Nördlinger Friedrich Wilhelm Doppelmayr, seit 1808 königlich bayerischer Landgerichtsassessor in Rosenheim, fertigte um 1814 einige Zeichnungen mit Motiven aus Oberaudorf an. So auch die 1809 vom Webermeister Georg Seybold erworbene Eremitage unterhalb der Wand, die er zu seiner Heimstätte umgebaut hat. Später entwickelte sich diese zu dem für den Bekanntheitsgrad von Oberaudorf so bedeutenden Gasthaus „Weber an der Wand“.
Friedrich Wilhelm Doppelmayr „Klause zu Oberaudorf“, 1814
Zar Alexander I. kehrte 1822 auf der Reise vom Tegernsee nach Italien bei der Alten Post in Fischbach ein. Auf der Weiterfahrt soll er dem zwischenzeitlich bekannten Weber und Gastgeber Seybold einen Besuch abgestattet haben.
Für das Auffinden von namhaften Personen, die im 19. Jahrhundert Oberaudorf besucht haben, stellen die beiden erhaltenen Gästebücher des „Weber an der Wand“ die wichtigste Quelle dar.
Mit Einträgen im „Fremdenbuch“ des Gastwirts dokumentierten 1832 der Würzburger Landschaftsmaler Fritz Bamberger und 1837 der Schriftsteller, Zeichner und Komponist Franz Graf von Pocci, der zudem Beamter am bayerischen Königshof war und wegen seiner Vorliebe fürs Marionettentheater auch „Kasperlgraf“ genannt wurde, ihre Aufenthalte. Auch der Landschafts- und Genremaler Carl Spitzweg hat Oberaudorf um 1840 mehrfach besucht. Dies kann man anhand seiner Tagebuchaufzeichnungen und mehrerer Zeichnungen gut nachvollziehen.
Mit Maximilian Herzog in Bayern besuchte 1846 erstmals ein Wittelsbacher den „Weber an der Wand“. Wegen seiner Leidenschaft für das Zitherspiel wurde er auch „Zither-Maxl“ genannt. 1858 folgten ihm die Kronprinzen Ludwig, der spätere König Ludwig III. von Bayern, und dessen jüngerer Bruder Leopold, in Begleitung ihrer Erzieher. 1860 besuchten Kronprinz Ludwig, späterer König Ludwig II., und Kronprinz Otto in Begleitung ihrer Mutter Königin Marie das Gasthaus.
Inbetriebnahme der Eisenbahn 1858
Mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnlinie von München über Rosenheim nach Kufstein im Sommer 1858 erhöhte sich die Zahl der Besucher in Oberaudorf drastisch. Dies konnte man an der Anzahl der Eintragungen im Gästebuch des „Weber an der Wand“ ablesen.
Zeichnung mit der Eisenbahn bei Oberaudorf
Tourismus um 1900
Der Schriftsteller Ludwig Steub sorgte für die Bekanntheit von Oberaudorf als Ziel für Sommerfrischler. In Oberaudorf begegnete er einer gewachsenen, noch ursprünglichen Volkskultur. Die Audorfer Almen schilderte er als das empfehlenswerteste Stück für das große Publikum im ganzen bayerischen Gebirge. Über den Verlauf der Eröffnungsfeier des Gasthauses „Tatzelwurm“ berichtete er ausführlich.
Eröffnung des Gasthauses „Zum feurigen Tatzelwurm“ am 15. August 1863
Eröffnung des Gasthauses „Zum feurigen Tatzelwurm“ am 15. August 1863
Ein weiterer Schilderer des hiesigen Alpenraumes war der Schriftsteller Heinrich August Noë. Sein Vorbild war wohl Ludwig Steub. Auch er half dem sich damals gerade entwickelnden „Fremdenverkehr“. So hat er sich 1860 in seinem „Brennerbuch“ auch über Oberaudorf ausgelassen. Von Tirol kommend überquerte er per Fähre den Inn bei Reisach. Dann beschreibt er, wie sich die Städter in Oberaudorf vergnügt haben.
Um 1900 hielt sich der Schriftsteller Martin Greif wegen der Schönheiten des Inntals oft mehrere Tage in Oberaudorf auf. Sein Trauerspiel „Konradin, der letzte Hohenstaufe“ wurde 1913 in Oberaudorf aufgeführt.
Eine Aufstellung von 1905 weist 15 Gasthäuser aus, nur noch sehr wenige sind davon übrig geblieben.
Bereits um 1880/1885 fanden sich die Oberaudorfer zu einer Organisation des Fremdenverkehrs zusammen, die sich „Verschönerungsverein“ nannte. Mit diesem Verein und dem Apotheker Carl Hagen ist die Entwicklung des Tourismus in Oberaudorf eng verbunden. Der Verschönerungsverein hat den größten Teil der Aufgaben im Bereich der örtlichen Infrastruktur übernommen. Die Gemeinde war außen vor und hat auf Antrag gelegentlich finanzielle Unterstützung gewährt. Der Verein sorgte für Baumpflanzungen entlang der Straßen und die Bepflanzung der Vorgärten, Ruhebänke wurden aufgestellt und fast jährlich wurden Sommer- und Winterprospekte in großer Stückzahl gedruckt und verteilt. 1895 gab es erstmals einen mehrseitigen Fremdenführer. Vergnügungsveranstaltungen wie Seefeste, Platz-/Standkonzerte und Dorfabende wurden organisiert. Schließlich rief der Verein Oberaudorfer Rund- und Fernfahrten ins Leben.
Bereits 1893 wurde der Bau eines Schwimmbades beschlossen, 1907 wurde ein neues Bad an der Stelle des alten gebaut.
1907 umgebautes Strandbad Luegsteinsee
Oberaudorf bestand um 1900 aus ca. 50 Gebäuden und hatte rund 900 Einwohner. Die kolorierte Postkarte zeigt Oberaudorf um 1920.
Mit dem Bau des Brünnsteinhauses im Jahre 1894 durch den Deutschen Alpenverein wurde das Bergwandern und Rodeln eingeführt. Den Weg zum Hocheck hatte die Gemeinde im Dezember 1908 zum Rodeln freigegeben.
Preisrodeln vom Hocheck
Für den sommerlichen Tourismus war der Luegsteinsee nach wie vor von großer Bedeutung, mittlerweile war er zu einem komfortablen Strandbad ausgebaut worden.
Zur Unterhaltung der Bevölkerung und der Gäste wurden um 1900 Trachtenvereine und Kapellen unterschiedlichster Besetzung gegründet.
Eine Besonderheit stellte das Oberaudorfer Heilwasser dar. Das Wasser des Auerbachs war für seine heilende Wirkung gepriesen. Die Trißler mineralhaltige Quelle kannte man bereits seit Jahrhunderten. Seit 1880 gab es eine gut gehende Wirtschaft mit Garten in Trißl. 1894 gestaltete man das Hauptgebäude um und richtete neue Fremdenzimmer ein. 1895 pries der Verschönerungsverein die Wannenbäder gegen rheumatische Leiden und Hautkrankheiten als besonders heilkräftig an.
Hauptgebäude von Trißl um 1910
Während und zwischen den Weltkriegen
Während man 1911 in Oberaudorf bereits 14.902 Übernachtungen zählte, gingen diese in der Zeit des 1. Weltkrieges drastisch zurück. Nach Ende des 1. Weltkrieges kamen erst langsam wieder mehr Urlauber nach Oberaudorf.
Unter Mitwirkung des Reichsarbeitsdienstes wurde der Luegsteinsee 1933 ausgebaut. 1937 erfolgte die Auszeichnung von Oberaudorf durch den Zusatz „Kurort“. 1934 verzeichnete der Ort erfreuliche 61.000 Übernachtungen, die Zuteilung von Urlaubern der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ hatte dazu erheblich beigetragen.
Als Beispiel für einen prominenten Besucher dieser Zeit hatte der Referent Franz Xaver Ritter von Epp ausgewählt. Im August 1933 war er bei Konsul Sachs in Oberaudorf zu Gast.
Nach dem 2. Weltkrieg waren die Fremdenzimmer bis Juli 1948 vom Flüchtlingskommissar beschlagnahmt. Vorteilhaft für den Fremdenverkehr war die Eröffnung des Sessellifts auf das Hocheck im Januar 1949.
Zeit des Wirtschaftswunders
Im Jahr 1956 war die Zahl der Übernachtungen bereits auf 110.000 gestiegen.
Die Eisenbahn ermöglichte es auch dem „Normalbürger“, zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, problemlos nach Oberaudorf zu reisen. Sonderzüge brachten im Sommer wöchentlich unzählige Gäste zum Beispiel der 1954 gegründeten Scharnow-Reisen, im Winter vom Sportscheck haufenweise die Skifahrer von München nach Oberaudorf.
Für die mit dem PKW anreisenden Gäste gab es mittlerweile eine zweispurige Autobahn im Inntal.
Neben dem Strandbad befand sich der Camping – Platz.
Camping – Platz am Luegsteinsee
In die Zeit des Wirtschaftswunders fielen auch prominente Besucher, einer davon war der Raketenforscher Wernher von Braun. 1937 trat Wernher von Braun in die NSDAP ein, 1940 wurde er Mitglied der SS. Kurz darauf wurde er zum SS-Sturmbannführer befördert. 1945 wurden die Raketenpioniere um Wernher von Braun nach Süddeutschland verlegt, um den anrückenden Besatzern zu entgehen. Beim alliierten Prozess 1947 war von Braun weder angeklagt noch als Zeuge geladen. Er stand mittlerweile in US-amerikanischen Diensten. Seine Eltern folgten ihm auf dem Weg nach Amerika. 1952 kehrten sie nach Deutschland zurück und lebten in Oberaudorf. Von Braun hat seine Eltern in Oberaudorf mehrmals besucht, so 1968 zum 90. Geburtstag seines Vaters.
Wernher von Braun mit Eltern, 1955 am Marienbrunnen in Oberaudorf
Ein weiterer prominenter Besucher von Oberaudorf war der Industriellenerbe, Bobfahrer, Fotograf, Dokumentarfilmer, Kunstsammler und Astrologe Gunter Sachs. Sein extrovertierter Lebensstil machte ihn in den 1960er und 1970er Jahren besonders als Prototyp des Gentleman-Playboys bekannt. Das Jagdhaus in der Rechenau am Fuße des Brünnsteins besuchte er häufiger. 1966 zelebrierte Gunter Sachs seine Flitterwochen mit Brigitte Bardot in der Rechenau.
Im Sommer 1973 verbrachte Bundeswirtschaftsminister Dr. Hans Friedrichs seinen Urlaub in Oberaudorf.
Tourismus Heute
Den heutigen Tourismus in Oberaudorf prägen nicht mehr die Namen einzelner Persönlichkeiten, sondern die Anzahl der Übernachtungen. Trotz hoher Besucherzahlen ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Gasthäuser sehr stark zurückgegangen.
Rückblickend ist festzustellen, dass es von 1880 bis 1936 den Verschönerungsverein gab, der 1911 beschloss, ein Fremdenverkehrsbüro einzurichten. Von 1936 bis 1950 lenkte der Verkehrsverein die Geschicke des Fremdenverkehrs in Oberaudorf. Ab 1950 führte der Verein die Bezeichnung „Kur- und Verkehrsverein“. Von 1938 bis 1950 gab es das Verkehrsamt im Kiosk des Busunternehmers Jupp Brendler. 1975 wurde im neuen Rathaus das Kur- und Verkehrsamt eingerichtet, 2003 dann in Tourist – Info umbenannt.
Auf zwei Folien zeigte Norbert Schön die Meilensteine des Oberaudorfer Tourismus ab den 1970er Jahren.
Von großer Bedeutung ist die Außendarstellung Oberaudorfs für den Tourismus. Mittlerweile bewirbt die Tourist-Information der Gemeinde den Ort vorrangig im Internet. Hier findet man reichlich Informationen rund um einen Aufenthalt im Ort.
Den Gästen wird eine ganze Reihe von Themenwanderungen angeboten, ebenso vielfältige Wintersportmöglichkeiten für Besucher aller Altersgruppen. Zunehmend schwierig wird es allerdings mit den sicheren Schneeverhältnissen.
Welche Bedeutung hat heute der Tourismus für Oberaudorf?
In 2022 konnten insgesamt rund 192.000 Übernachtungen registriert werden. Allein durch Übernachtungsgäste bringt der Tourismus einen Umsatz von geschätzt 20 Mio € pro Jahr ins Dorf, dazu noch Tagestourismus, Gastronomie und Liftbetrieb. Der Tourismus bedeutet also einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für unsere Gemeinde.
Exkursion zum Schloss Hohenaschau und nach Niederaschau
Am 25. Oktober 2024 fuhren Mitglieder des Historischen Vereins Audorf und einige Gäste mit PKWs in Fahrgemeinschaften nach Aschau. Auf Schloss Hohenaschau wurden die Teilnehmer von der Frasdorfer Historikerin Martina Stoib begrüßt und nach einer kurzen Einführung in die Geschichte von Burg und Schloss Hohenaschau durch das Schloss geführt. Mit ausdrucksvoller Mimik und profunder Sachkenntnis brachte uns Frau Stoib die große Bedeutung von Hohenschau näher.
Die Historikerin Martina Stoib bei der Begrüßung und Einführung in die Geschichte von Hohenaschau
Einige wenige bedeutende Adelsgeschlechter haben in 850 Jahren Hohenaschau ihren Stempel aufgedrückt. Die Herren von Hirnsberg, die Freiherren von Freyberg, die Grafen von Preysing und die von Cramer - Kletts prägten mit ihrem Einfluss Land und Leute im Chiemgau.
Durch das sogenannte Rittertor ging es über die Vorburg in den Innenhof der Burganlage und in die barocke Schlosskapelle. Diese wurde während der Um- und Erweiterungsbauten des Schlosses in der Zeit von 1540-1560 errichtet und während des Hochbarocks 1672-1686 umgebaut.
Innenraum der barocken Schlosskapelle
Nach dem Besuch der Schlosskapelle kamen wir im Nordflügel der Ringburg in den ältesten Raum auf Hohenaschau, in dem die Baugeschichte dokumentiert ist. Angereichert mit einigen Anekdoten schilderte uns Frau Stoib die Geschichte und das Leben der Adelsfamilien sehr lebhaft.
Im Innenhof der ehemaligen Ringburg
Im 11. Jh. beherrschten die Falkensteiner das Gebiet um Hohenaschau, diese wiederum übertrugen dessen Verwaltung an die Herren von Hirnsberg. Konrad und Arnold von Hirnsberg erbauten einen Stützpunkt am Eingang in das obere Priental. Die mittelalterliche Ringburg auf einem Felsrücken hoch über dem Priental bestand wohl aus Palas, Turm und Ringmauer. In der Folge nannte sich das Geschlecht der Hirnsberger „Aschauer“. Nach deren Aussterben gelangte die Burg im 14. Jh. an Konrad Freiherr von Freyberg. Unter der Herrschaft der Freyberger erlebte Hohenaschau in mehr als 200 Jahren einen umfangreichen Umbau. Pankratz von Freyberg baute das Schloss im Stil der Renaissance aus. Nach dem Aussterben der männlichen Linie der Freyberger kam Hohenaschau durch Heirat in den Besitz der Freiherren von Preysing. Diese bauten das Schloss zum Mittelpunkt der Verwaltung ihrer Herrschaft aus. Bei den Um- und Erweiterungsbauten des Schlosses im Stil des Hochbarocks Ende des 17. Jhs. wurde der Festsaal im Südflügel der Burg und die barocke Schlosskapelle mit Benefiziatenhaus in der Vorburg errichtet.
Zweimal wurde das Schloss im 18. und im 19. Jh. angegriffen und geplündert.
Nach dem Aussterben der Grafen von Preysing wechselten mehrfach die Besitzer von Hohenaschau. Da diese meistens nur an den Ländereien interessiert waren, verfiel das Schloss.
1875 erwarb der Industrielle Theodor von Cramer – Klett Herrschaft und Schloss Hohenaschau. Es folgten umfangreiche bauliche Veränderungen. 1942 musste die Familie Cramer - Klett das Schloss aus wirtschaftlichen Gründen an das Deutsche Reich verkaufen. Heute gehört das Schloss der Bundesrepublik Deutschland. Seit 1960 bietet es zu einem großen Teil Platz für das Sozialwerk der Bundesverwaltung und wird als Ferien- und Erholungsheim genutzt.
Unser Rundgang wurde danach mit dem barocken Laubensaal fortgesetzt. Dieser ist mit szenischen Darstellungen ausgestattet und eine überregional bedeutsame kunsthistorische Sehenswürdigkeit. Max II. von Preysing ließ diesen Speisesaal von den Malern Joseph Eder und Jakob Carnutsch mit Motiven römischer Gärten verzieren.
Über den Innenhof führte Frau Stoib durch das prächtige Treppenhaus in den Südflügel zu den von italienischen Stuckateuren gestalteten Preysingsälen, die uns mit ihrem Prunk sehr beeindruckten. Im großen Festsaal, der mittels monumentaler Murano – Kronleuchtern beleuchtet wird, sind ringsum in Überlebensgröße die Ahnen des Preysing – Geschlechts dargestellt.
Der prunkvolle Festsaal des Schlosses
Nach dem zweistündigen Rundgang durch das Schloss erklärte uns Martina Steub das Prientalmuseum, das sich im ehemaligen Benefiziatenhaus befindet. Das Museum zeigt ausführlich die Geschichte der Mitte des 16. bis Ende des 19. Jhs. bedeutenden Eisenverarbeitung in der Umgebung von Hohenaschau entlang des Hammerbaches. Wunderbare Modelle bilden die einzelnen Schritte der Eisenverarbeitung nach. Daneben präsentiert das Museum vorgeschichtliche Funde der Bronzezeit sowie die Geschichte der Familie Cramer – Klett.
Vitrine mit dem bronzezeitlichen Hortfund von Aschau-Weidachwies
Dann ging es erstmal in ein nahe gelegenes Gasthaus zum Mittagessen, das alle sehr genossen haben.
Gewandet im historischen Kostüm der Hofwirtin Maria Anna Schropp, die von 1697 bis 1777 gelebt hat, führte Martina Stoib am Nachmittag unsere Gruppe durch das historische Aschau.
Dabei ließ sie das frühere Niederaschau mit vielen Geschichten und fundierter Sachkenntnis wieder lebendig werden. Auf dem Platz zwischen dem ehemaligen Hofwirt, der heutigen „Residenz Winkler“, und der Pfarrkirche von Niederaschau, ging Martina Stoib ausführlich auf die Geschichte der Gemeinde Niederaschau und deren Pfarrkirche ein.
Einen besonderen Platz nahm dabei die ehemalige Hofwirtin ein. Ausführlich schilderte Frau Stoib Leben und Wirken der Maria Anna Schropp, Mutter von 16 Kindern und Gattin zweier Ehemänner. Sie überlebte ihren letzten Gatten um 20 Jahre und verstarb mit 80 Lebensjahren. Die Hofwirtschaft hatte sie von ihrem überaus vermögenden Vater geerbt. Sie selbst betrieb die Hofwirtschaft erfolgreich und vermehrte somit ihr Vermögen. Daraus stiftete sie einen reich verzierten und mit Reliquien bestückten Seitenaltar in der Pfarrkirche, wovon wir uns bei deren Besichtigung überzeugen konnten. 1752 ließ sie neben der Pfarrkirche die Kreuzkapelle errichten.
Auf dem Rundgang durch Niederaschau
Nach einem ausführlichen Rundgang durch Niederschau endete die überaus gelungene und informative Exkursion in die Geschichte von Schloss Hohenaschau und Gemeinde Niederaschau.
Burgen-Exkursion der Uni Zürich
Am 19. Juni besuchte eine Gruppe Schweizer Archäologie- und Kunstgeschichte Studentinnen und Studenten Oberaudorf. Im Rahmen einer 5tägigen Burgen-Exkursion stand am letzten Tag Oberaudorf auf dem Programm. Unter der Leitung des uns seit vielen Jahren der Zusammenarbeit bekannten Archäologen Dr. Elias Flatscher sollten das Museum im Burgtor, die Auerburg und die Höhlenburg in der Luegsteinwand (Grafenloch) besichtigt werden.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Norbert Schön vor dem Museum erläuterte Michael Steigenberger den Aufbau und die wichtigsten Inhalte des Museums.
Nach einer kurzen Frühstückspause musste sich die Gruppe aus Zeitgründen trennen. Der größere Teil ging mit M. Steigenberger auf die Auerburg, der Rest der Gruppe stieg mit flottem Schritt zum Grafenloch hoch.
Dort erklärte E. Flatscher die Baugeschichte und die mögliche Nutzung der hochmittelalterlichen Höhlenburg.
Der gemeinsamen Brotzeit im Ort folgte dann die Weiterfahrt der Besuchergruppe zum Schloss Neuschwanstein.
Exkursion zur Bayerischen Landesausstellung nach Freising
Am 18. Mai ging es mit dem Bus zur diesjährigen Bayerischen Landesausstellung „Tassilo, Korbinian und der Bär – Bayern im frühen Mittelalter“ nach Freising. Im Bus gab der 1. Vorsitzende einen kurzen Abriss über die Geschichte der Stadt Freising. Im frühen Mittelalter war der Ort unter dem Namen Frigisinga eine Herzogspfalz im ersten bairischen Stammesherzogtum. Um 715 wurde Freising eine agilolfingische Residenz, zu der eine Burg, ein Wohnsitz und eine Marienkapelle gehörten. Freising ist die einzige bekannte Stadtgründung der bajuwarischen Agilolfinger und damit die älteste Stadt in Oberbayern.
Nach Ankunft in Freising besuchten die Exkursionsteilnehmer die Altstadt und bestaunten einige der herrlichen Bauten mit ihren wunderschönen Fassaden.
Die aus rotem Marmor bestehende Mariensäule am zentral gelegenen Marienplatz wurde 1674 zur Verehrung Marias als Patrona Bavariae von Fürstbischof Albrecht Sigismund gestiftet.
Bevor die Exkursionsteilnehmer individuell die Stadt weiter erkunden konnten, erzählte der 1. Vorsitzende kurz die Geschichte des Freisinger Doms. Der Bayernherzog Theodo gründete um 715 eine Marienkirche auf dem Freisinger Burgberg. 739 wurde die Marienkirche zur Bistumskirche auf dem Domberg. In den Jahren 855 bis 875 baute Bischof Anno einen größeren Dom im Stil einer altchristlichen Basilika. Nach einem verheerenden Brand, der alles vernichtete, baute Bischof Adalbert den Dom und die anderen Gebäude in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts neu auf. Ende des 15. Jahrhunderts wurde der Dom nach gotischen Gesichtspunkten angepasst und an Stelle der bisherigen flachen Decke ein Gewölbe eingezogen. Im 17. Jh. wurde der Dom nach den ästhetischen Vorstellungen der Renaissance umgebaut. Weißes Stuckrahmenwerk ersetzt seitdem das gotische Rippengewölbe. Das Hochaltarbild stammte vom größten Maler der Zeit, Peter Paul Rubens. 1724 gestalteten der Bildhauer Egid Quirin Asam und sein Bruder, der Maler Cosmas Damian Asam, den Innenraum des Domes mit reichhaltigen Stukkaturen neu.
Nach dem Mittagessen in einem Restaurant am Marienplatz ging es auf den Domberg.
Dort bestaunten wir zunächst den herrlichen Dom mit seiner Ehrfurcht erweckenden Krypta. Im Dom gab uns Elisabeth Rechenauer, Kunsthistorikerin und Vereinsmitglied, interessante Erläuterungen zu den kunsthistorischen Details.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts befinden sich die Reliquien des hl. Korbinian im Korbiniansschrein.
Danach ging es zum Diözesanmuseum, wo die Landesausstellung präsentiert wird. In zwei Gruppen unterteilt ließen wir uns durch die Ausstellung führen.
Gleich zu Beginn begegneten wir dem Schutzpatron der Diözese München – Freising,
Bischof Korbinian und dem präparierten Bär Bruno.
Hier ging die Führung eingehend auf die Geschichte des Missionars und die Legende um Korbinian und dem Bär ein. Diese erzählt, dass Korbinian auf einer Reise nach Rom einem wilden Bären begegnet sei. Nachdem der Bär das Packpferd getötet hatte, zähmte Korbinian den Bären und ließ ihn die Lasten tragen. Soweit die Legende. Der aus Irland stammende Korbinian entschied sich in jungen Jahren für das Leben eines Eremiten. Bei seinen Pilgerreisen nach Rom bewegte der Papst Korbinian dazu, das Einsiedlerdasein zugunsten der Missionsarbeit aufzugeben.
Der agilolfinger Herzog Theodo pilgerte 715 nach Rom und bat Papst Gregor II. um die Errichtung von Bischofssitzen in Bayern. Dies führte ein Jahr später zur päpstlichen Instruktion, vier Bischofssitze in Regensburg, Passau, Salzburg und Freising zu gründen. Bei seinen Bestrebungen, dem Herzogtum Bayern-Freising eine kirchliche Ordnung zu geben, unterstützte Korbinian Herzog Grimoald. Auf Wunsch des Herzogs ließ er sich um 720 bei Freising nieder.
Durch sein Wirken machte Korbinian Freising zu einem bedeutenden geistlichen Zentrum in Bayern. Nachdem Korbinian die nach damaligem Kirchenrecht verbotene Eheschließung des Herzogs mit der Frau seines verstorbenen Bruders beanstandete, kam es zum Streit mit Grimoald und Korbinian musste Freising verlassen.
Einen großen Raum nahmen in der Ausstellung die ersten Missionare ein, die Bayern im 8. Jhd. besucht hatten. Zu ihnen zählten neben Korbinian der angelsächsische Bonifatius, der die Bistümer Würzburg und Eichstätt gegründet hat. Weiter der Wandermönch Emmeram, der u.a. in Regensburg wirkte sowie Rupert, der Schutzheilige von Salzburg. Er ließ dort die Peterskirche bauen und gründete das Kloster Nonnberg.
Wie bereits der Titel angekündigt hat, bildete der Bayernherzog Tassilo III. einen weiteren Schwerpunkt der Ausstellung. Tassilo war mit dem mächtigen Frankenkönig Karl der Große verwandt. Der siebenjährige Tassilo wurde unter der Vormundschaft seiner Mutter, der bairischen Herzogin Hiltrud, als Herzog von Baiern eingesetzt. Im Jahr 757 übernahm Herzog Tassilo III. die Alleinregierung in Baiern.
Tassilo nahm auf das kirchliche Leben in seinem Herzogtum starken Einfluss. Er stiftete Klöster und beteiligte sich an der Gründung von Adelsklöstern, um eine Herzogskirche aufzubauen.
Unter anderen gehören Kloster Frauenchiemsee und Kloster Innichen im heutigen Südtirol dazu.
Herzog Tassilo hielt sich mehrfach in Italien auf und verbündete sich mit dem Langobardenkönig Desiderius, dessen Tochter Liutperg er heiratete.
Der königsgleiche Tassilo erreichte eine territoriale Machtstellung, die vor ihm kein anderer Agilolfinger besessen hatte. Damit war Tassilo III. Karl dem Großen zu mächtig geworden und so marschierte Karl im Jahr 787 mit drei Heeren in Bayern ein. Tassilo unterwarf sich auf dem Lechfeld bei Augsburg, leistete einen Treueeid und nahm sein Herzogtum vom König zu Lehen.
788 berief König Karl einen Reichstag in Ingelheim ein. Tassilo kam dorthin auf Weisung des Königs. In einem Schauprozess wurde ihm vorgeworfen, er habe Karl den Treueeid gebrochen. Daraufhin verurteilte ihn Karl zum Tode, begnadigte ihn aber mildherzig und verbannte ihn ins Kloster.
Den Höhepunkt der Führung bildete der originale Tassilo-Kelch. In einer Glasvitrine erstrahlte dieses wahrlich beeindruckende Kunstwerk frühmittelalterlicher Goldschmiedekunst.
Der Kelch wurde von Tassilo III. und seiner Gemahlin Liutperg dem Bischof von Krems um 780 gestiftet. Er zeigt Christus als König, das Stifterpaar und weitere Details der christlichen Lehre.
Mit vielen Informationen zu Freising, dem Dom und dem frühen Mittelalter Bayerns „gefüttert“ ging es am Abend zurück nach Oberaudorf.
Besuch der Ausstellung "Sehnsuchtsblaue Ferne! Der Münchner Landschaftsmaler August Seidel (1820-1904) und Weggefährten in der Städtischen Galerie Rosenheim
Am 20. April besuchte eine Gruppe interessierter Mitglieder des Vereins die Gemäldeausstellung in der Städtischen Galerie Rosenheim. Durch die Ausstellung führte der 1. Vorsitzende, der an den Vorbereitungen zur Ausstellung selbst beteiligt war. Zunächst ging Norbert Schön auf das Entstehen der Ausstellung ein. Im Wesentlichen ist es dem Münchner Raketenforscher Prof. Dr. Robert Schmucker zu verdanken, der mit der Gründung der Forschungsstelle August Seidel Leben und Wirken des Münchner Landschaftsmalers erforschen ließ.
In der Ausstellung wird eine große Zahl beeindruckender Werke in großem und kleinem Format gezeigt. Daneben bietet sie viele Arbeiten von Künstlern, die entweder Vorbild, Lehrer oder Weggefährten von August Seidel waren. Da findet man Gemälde bekannter Maler, wie z.B. des Heidelbergers Carl Rottmann, der Dresdener Brüder Albert und Max Zimmermann und des Münchners Carl Spitzweg.
Norbert Schön erklärte, wie es zu der „Sehnsucht“ nach den Motiven vor und in den bayerischen Alpen gekommen und wie der Werkprozess bei der Entwicklung eines Gemäldes abgelaufen ist. Angereichert war die Ausstellung durch eine Reihe originaler Malutensilien und Skizzenbücher von August Seidel. Am Ende der Führung waren alle Teilnehmer von der Ausstellung begeistert, und einige ließen das Gesehene bei der Einkehr im Gasthaus ´Zum Johann Auer´ noch nachklingen.
Besichtigung des Museums in der Festung Kufstein und Rundgang auf der Festung
Ergänzend zum Vortrag über die neuesten Grabungen in der Tischoferhöhle besuchten wir am 27. April das Museum auf der Festung Kufstein. Der uns bereits von einer früheren Führung her bekannte Austrian-Guide Dr. Nagiller empfing uns auf der Festung und begann seine Führung mit einem Abriss der Geschichte der Stadt Kufstein und der Festung.
Anschließend ging es zum Museum, wo vereinbarungsgemäß nur der Raum mit den vorgeschichtlichen Funden aus der Tischoferhöhle besucht wurde. Dr. Nagiller berichtete über die Ergebnisse der früheren Grabungen mit Schwerpunkt auf die Arbeit des Münchner Paläontologen Prof. Schlosser von 1909. Schon beim Betreten des abgedunkelten Raumes beeindruckte das Skellett eines riesengroßen, aufrecht stehenden Höhlenbären.
Nicht minder interessant waren die zahlreichen Zeugnisse von menschlichen Aufenthalten in der Höhle, die von der Alt-Steinzeit vor rund 40000 Jahren, bis in die Bronzezeit etwa 2000 Jahre v. Chr. reichen.
Den Abschluss der Führung bildete der Besuch der Heldenorgel und des „Tiefen Brunnen“.
Durch einen langen, in den Fels gehauenen Gang ging es zurück zum Festungsrestaurant, wo die Exkursion bei angenehmem Wetter und gutem Mittagessen im Freien zu Ende ging.
Vortrag "Von neuen Grabungen und alten Funden - Forschungen zur Tischoferhöhle bei Kufstein"
Im Kursaal der Gemeinde Oberaudorf hielt am 11. April der Archäologie Dr. Joachim Pechtl den Vortrag zu den Erkenntnissen früherer und aktueller archäologischer Grabungen in der Tischoferhöhle. Nach der Begrüßung durch den Vorstand des Vereins und der Vorstellung von Joachim Pechtl berichtete dieser zu Beginn ausführlich über Grabungen und Funde bis in jüngste Zeit.
Es begann bereits 1607 mit einem Brief von Karl Schurff, dem Burghauptmann der Feste Kufstein, an Erzherzog Maximilian III, in dem er auf Knochenfunde in der Höhle hingewiesen hat.
Die erste wissenschaftliche Grabung leitete der 1. Inhaber der Lehrkanzel für „Mineralogie und Geognosie“ der Universität Innsbruck, Adolf Pichler, 1859. Er gilt als der „Entdecker“ der sogenannten „Knochenhöhle“.
Weitere Grabungen fanden in den Jahren 1905, 1906 und 1907 auf Veranlassung des „Historischen Vereins“ Kufstein statt. 1906 wurden in der Tischoferhöhle durch Prof. Schlosser aus München mit Herren des Historischen Vereins und sechs Arbeitern Ausgrabungen vorgenommen, welche überraschende Ergebnisse brachten.
Es wurden Menschenknochen, Gefäße, Bronzenadeln, ein Steinbeil und ein Höhlenbärenschädel gefunden. Leider haben Schlosser vorrangig die paläontologischen Funde – also insbesondere große Tierknochen – interessiert, an den archäologischen Funden hatte er kein besonderes Interesse. Die Ergebnisse dieser Grabungen wurden bereits 1909 in einer umfangreichen wissenschaftlichen Veröffentlichung vorgestellt. Leider sind dort aber nur sehr eingeschränkt Anhaltspunkte zum konkreten Vorgehen bei den damaligen Grabungen zu finden.
Archäologen an der Universität Innsbruck haben sich gefragt, ob bei den sehr umfangreichen früheren Grabungen tatsächlich der gesamte Höhlenboden ausgeräumt wurde - oder ob noch irgendwo ungestörte Reste vorhanden sind. Mit diesem Ansatz fanden dann 2022 und 2023 unter der Leitung von Joachim Pechtl Lehr-Grabungen mit Studenten der Uni Innsbruck statt.
Blick aus dem Höhleninneren
Die Frage, ob es in der Höhle nach all den früheren Grabungen noch ungestörte Bereiche gibt, sollte mittels Bohrungen geklärt werden. Unter Beachtung diverser Kriterien wurde eine geeignete Stelle ausgewählt. Die Untersuchung der Bohrkerne zeigte, dass man tatsächlich so eine „unberührte“ Stelle gefunden hatte.
Die anschließenden Grabungen und Auswertungen ergaben tatsächlich neue Funde. In aufwändiger Arbeit siebte, reinigte und dokumentierte das Grabungsteam sämtliches geborgenes Material. Die Funde passten in das bisher bekannte Fundspektrum.
Dabei handelt es sich um menschliche Reste einer Bestattung in der Steinzeit, eiszeitliche Tierknochen von Höhlenbären, Zahnartefakte und unscheinbare Feuersteine (Silex). Deren Vorhandensein bezeugt die Anwesenheit von Menschen der Steinzeit, da in diesem Zeitraum Werkzeuge und Waffen insbesondere aus Silex bestanden haben. Die Erforschung der Herkunft der Feuersteine ergab Aufschluss auf mögliche Aufenthaltsorte der Steinzeitmenschen. Exemplare aus dem Donaugebiet bei Kehlheim machen es wahrscheinlich, dass ausgehend von einer größeren Gruppe im dortigen Gebiet mehrere Basislager aufgesucht wurden, von denen aus wieder einzelne Gruppen von Jägern die ihnen bekannten Orte wie die Tischoferhöhle aufgesucht haben. Dort konnten dann zum Beispiel im Winter vergleichsweise ungefährlich Höhlenbären im Winterschlaf erlegt werden.
Die zeitliche Einordnung aller bisherigen Funde lässt darauf schließen, dass sich Menschen bereits in der Altsteinzeit vor ca. 40.000 Jahren, also zwischen den letzten beiden maximalen Vereisungen des Voralpenraumes, in der Höhle aufgehalten haben. Dann wieder in der Jungsteinzeit des 4. Jahrtausend vor Chr., in der Bronzezeit 2200-1800 v. Chr. und bis in die Neuzeit haben Menschen die Höhle besucht.
Mit Spannung werden die weiteren Auswertungen erwartet, über die dann zu einem späteren Zeitpunkt berichtet werden wird.
Mit viel Applaus bedankten sich die Zuhörer bei Dr. Joachim Pechtl. Nach der anschließenden Diskussionsrunde verabschiedete der Vereinsvorstand den Referenten und die Zuhörer.
Erfolgreiche Ausstellung „2500 Jahre Kunst in Audorf“
Sicherlich Höhepunkt des Vereinsjahres 2019, aber auch für das Kulturleben in Oberaudorf selbst, war die zweiwöchige Ausstellung „2500 Jahre Kunst in Audorf – Von den Kelten bis Heute“, die der Historische Verein Audorf im August im Zuge seines 30jährigen Bestehens präsentiert hat..
Den reich bebilderten Ausstellungskatalog gibt es nach wie vor in der Tourist-Info der Gemeinde Oberaudorf und beim Historischen Verein Audorf e.V. .